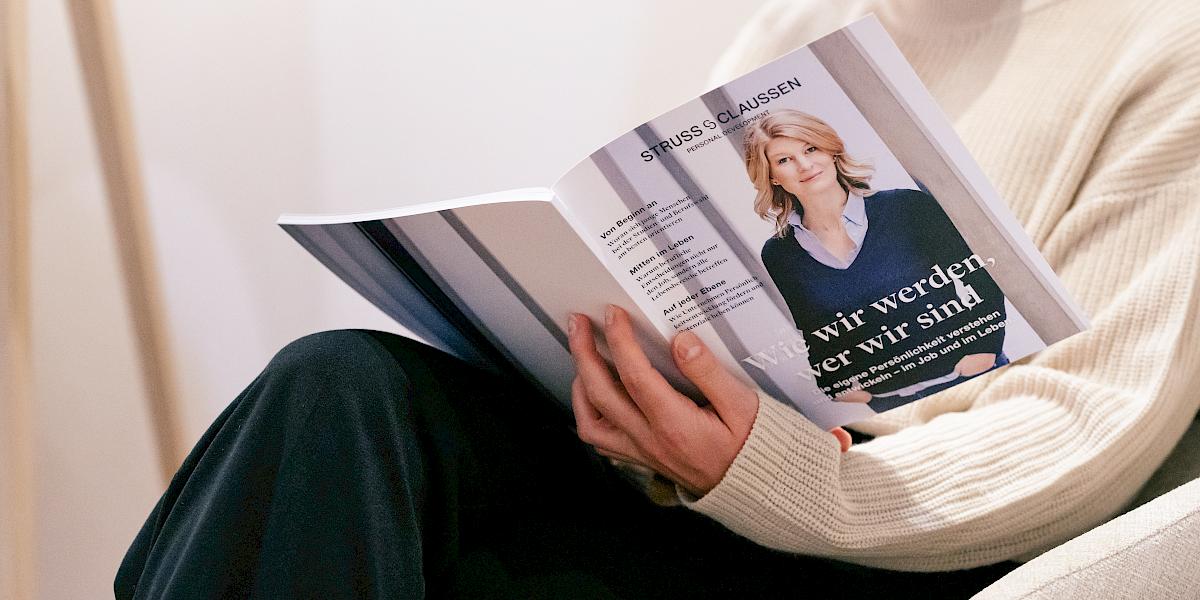In unsicheren Zeiten führen – von der Relevanz, Sicherheit zu stiften

von Anna Schmitz
In unsicheren Zeiten führen – von der Relevanz, Sicherheit zu stiften
Angst und gesellschaftliche Trends: Zukunftsängste im Wandel
Angst am Arbeitsplatz entsteht nicht isoliert. Sie wird maßgeblich durch gesellschaftliche Großtrends geprägt, die kollektive Unsicherheiten erzeugen und individuelle Ängste verstärken oder neu formen. Das bedeutet: Was Menschen heute am Arbeitsplatz fürchten, hängt eng mit den Veränderungen und Krisen der Welt außerhalb des Unternehmens zusammen, und davon gibt es nicht zu wenige. Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich die prägenden Ängste deutlich verschoben und sie sind relevant, auch und gerade für Unternehmen. Aus unseren Beobachtungen und dem Austausch mit unseren Kunden leiten wir die folgenden Entwicklungen und Ängste als aktuell prägend ab. Erkennst du diese auch in deinem Team?
Technologischer Wandel und Angst vor Ersetzbarkeit
Künstliche Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung revolutionieren ganze Branchen. Viele Menschen fürchten, dass ihre Arbeitskraft an Bedeutung verliert, sie durch Maschinen ersetzt werden oder dass neue Anforderungen sie überfordern könnten. Besonders betroffen: Routinetätigkeiten, Verwaltung, Produktion, aber zunehmend auch kreative und analytische Berufe.
Es entsteht die Angst, nicht mithalten zu können. Der damit einhergehende Druck sich ständig neu qualifizieren zu müssen. Und die grundsätzliche Frage, welche Berufe überhaupt noch zukunftsfähig sind, insbesondere bei unseren jüngeren Kund*innen.
Globalisierung und Angst vor Instabilität
Die weltweite Vernetzung führt zu höherem Wettbewerb, aber auch zu einer stärkeren Anfälligkeit für globale Krisen (z. B. Wirtschaftskrisen, Lieferkettenprobleme, geopolitische Konflikte). Arbeitsplätze erscheinen weniger „sicher“, lokale Krisen können schnell globale Auswirkungen haben. Die Stabilität, die aufgebaut wird, scheint von mehr Playern als früher bedroht zu werden.
Die Folge sind Verlustängste, besonders in ehemals stabilen Branchen. Zunahme existenzieller Unsicherheiten auch in hochqualifizierten Berufsfeldern. Stark ausgeprägtes Sicherheitsverhalten für den theoretischen Fall, dass etwas passieren könnte.
Klimawandel und ökologische Zukunftsängste
Der Klimawandel stellt nicht nur die Welt insgesamt vor Herausforderungen, sondern verändert auch Branchenstrukturen (z. B. in der Energieversorgung, Automobilindustrie, Landwirtschaft). Viele junge Arbeitnehmer:innen tragen ein tiefes Bewusstsein für ökologische Verantwortung – und gleichzeitig Ängste, ob die eigene Arbeit Sinn stiftet oder eher schädlich wirkt.
Daraus resultieren Sinnfragen, die heute in größerem Ausmaß empfunden werden: „Trage ich mit meinem Beruf zu einer besseren Zukunft bei oder zerstöre ich sie?“ Auch wertebasierte Jobwechsel oder bewusster Rückzug aus bestimmten Industrien (z. B. fossile Energie) werden häufiger. Das Sinnempfinden wird zum maßgeblichen Handlungsimpuls in Jobentscheidungen.
Soziale Umbrüche und Identitätsunsicherheiten
Themen wie Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion und neue Geschlechterrollen verändern Arbeitsplätze kulturell. Menschen erleben neue Anforderungen an Sensibilität, Sprache und Umgangsformen. Es entsteht ein neues Konfliktpotenzial durch unterschiedliche Sichtweisen und emotional aufgeladene Positionen.
Vor allem bei unseren erfahreneren Kunden und Kundinnen ist heute die Angst zu beobachten, unabsichtlich „Fehler“ zu machen oder nicht mehr „dazuzugehören“. Dadurch, dass es heute mehr Kategorien gibt, leiden viele unter einer Verunsicherung über die eigene soziale Rolle am Arbeitsplatz.
Pandemieerfahrungen und Angst vor Kontrollverlust
Die COVID-19-Pandemie hat weltweit kollektive Erfahrungen von Unsicherheit, Kontrollverlust und sozialer Isolation ausgelöst. Auch wenn die akute Phase überwunden ist, bleiben Spuren: die Angst vor erneuten Krisen, plötzlicher Arbeitslosigkeit oder grundlegender Veränderung des Arbeitsalltags (z. B. durch Remote Work). Ganze Generationen haben nur abgeschwächte Entwicklungserfahrungen gemacht, die für den Arbeitskontext relevant sind, wie zum Beispiel Jugendliche, die in der Pubertät unter Pandemiebedingungen die Sozialisierung mit ihren Peers anders gelebt haben, als andere Generationen davor. Dieser Mangel an Erfahrung kann insbesondere im sozialen Kontext Unsicherheiten schüren.
Höheres Bedürfnis nach Sicherheit auf der einen und Flexibilität auf der anderen Seite sind die Folge. Größere Sensibilität gegenüber Gesundheit, psychischer Belastung und sozialer Unterstützung. Geringeres Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe und dadurch stärkere Berücksichtigung der Eigeninteressen im Vergleich zu den Teaminteressen.
Die Ängste, die Menschen heute am Arbeitsplatz empfinden, verändern die Erwartungen an Arbeitgeber, an Führung, an Sinnstiftung und an die Gestaltung von Arbeitsplätzen selbst.
Unternehmen und Führungskräfte müssen diese kollektiven Ängste verstehen, um zukunftsfähige Arbeitskulturen zu schaffen, die nicht nur auf Leistung, sondern auch auf Sicherheit, Sinn und Entwicklung setzen. Denn solange Ängste unerkannt bleiben, führen sie zu Vermeidungsverhalten und sabotieren ganze Teams und Arbeitsprozesse. Werden sie hingegen erkannt, bieten sie unendliches Potenzial. Denn wenn Unternehmen, die ihrerseits ebenfalls ungleich großen Unsicherheiten unterworfen sind, ihren Mitarbeitenden Sicherheit geben, bekommen auch sie sie zurück – in Form von loyalen, konstanten und belastbaren Angestellten. Und das ist ein echter Wettbewerbsvorteil.
Die Verantwortung der Unternehmen in einer krisengeplagten Welt
Unternehmen sollten sich strategisch und strukturell darauf einstellen, dass Zukunftsängste die Arbeitswelt dauerhaft prägen. Hier die wichtigsten Anforderungen, die daraus entstehen:
Unternehmen sollten psychologische Sicherheit aktiv gestalten
In einer Welt voller Unsicherheiten wird psychologische Sicherheit (das Gefühl, dass man sich ohne Angst vor negativen Konsequenzen äußern, Fehler machen und authentisch sein kann) zur wichtigsten Voraussetzung für Innovation, Zusammenarbeit und Engagement.
- Führungskräfte darin schulen, empathisch zu kommunizieren und Fehler nicht zu bestrafen – (vor-)gelebte Fehlerkultur.
- Aktive Einladung zu offenen Fragen, kritischem Feedback und kreativen Ideen („Was brauchen Sie, damit Sie sicher arbeiten können?“, „Wenn sie das kritisieren müssten, was würden sie kritisieren?“).
- Räume für Reflexion schaffen, etwa regelmäßige Team-Check-ins oder Retrospektiven, die auf die Aufarbeitung von Fehlern abzielen.
Unternehmen sollten Transparenz und Verlässlichkeit bieten
Zukunftsängste verschärfen sich besonders dann, wenn Informationen fehlen oder Prozesse intransparent sind. Menschen brauchen klare Orientierung, auch (und gerade) dann, wenn noch nicht alle Antworten vorliegen.
- Frühzeitige und klare Kommunikation über Veränderungen, Entscheidungen und Unternehmensausrichtungen.
- Ehrliches Eingestehen von Unsicherheiten („Wir wissen noch nicht alles, aber wir sind in der Lage, gemeinsam damit umzugehen.“) und den Schritten, die dagegen unternommen werden.
- Verlässliche Werte und Prinzipien schaffen, auf die sich Mitarbeitende auch in unübersichtlichen Zeiten verlassen können – weil sie gelebt werden (z.B. eine Policy einhalten, die sich auf Arbeitszeiten oder die Nutzung von Diensthandys bezieht).
Unternehmen sollten Entwicklung ermöglichen und Absicherung bieten
In einer Welt ständigen Wandels wächst die Angst, den Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden. Unternehmen tragen die Verantwortung, Mitarbeitende nicht einfach dem Wandel auszusetzen, sondern sie aktiv zu befähigen und abzusichern.
- Investitionen in kontinuierliche Weiterbildung und Entwicklung (nicht nur fachlich, sondern auch emotional-kommunikativ) in zukunftsrelevanten Bereichen.
- Angebote für individuelle Laufbahnberatung, Talententwicklung und neue Karrierepfade.
- Transparente Entwicklungsperspektiven schaffen, die auch Quereinstiege und Umorientierungen ermöglichen.
Unternehmen sollten Sinnstiftung ernst nehmen
Besonders jüngere Generationen (Millennials, Gen Z) spüren nicht nur Zukunftsangst, sondern stellen bewusst die Frage nach Sinn und Wert ihrer Arbeit.
In einer Welt, in der ökologische und soziale Krisen präsent sind, reicht „nur Geld verdienen“ für viele nicht mehr aus.
- Die Unternehmensmission klar an gesellschaftlich relevanten Beiträgen ausrichten („Wozu leisten wir einen positiven Beitrag?“). Wenn das eigene Produkt nicht unmittelbar einen Mehrwert stiftet, kann es ein Projekt geben, das durch das unternehmerische Handeln profitiert.
- Mitarbeitende aktiv in Sinnfragen einbinden („Wie möchten wir gemeinsam Wirkung erzielen?“).
- Corporate Responsibility ernsthaft betreiben und nicht als oberflächliches Marketinginstrument verwenden.
Unternehmen sollten Flexibilität und Stabilität zugleich bieten
Eine paradoxe, aber zentrale Anforderung: Menschen brauchen heute Flexibilität, um auf Veränderungen reagieren zu können, aber auch stabile Rahmenbedingungen, um sich sicher fühlen und entfalten zu können.
- Flexible Arbeitsmodelle (z. B. Homeoffice, Teilzeit, Sabbaticals) ermöglichen – aber innerhalb klarer, verlässlicher Vereinbarungen.
- Klare Strukturen und Entscheidungswege schaffen, die nicht starr, aber nachvollziehbar sind.
- Sicherheit nicht durch Kontrolle, sondern durch Absprachen, Vertrauen und transparente Konsequenzen aufbauen.
Unternehmen sollten Gesundheit ganzheitlich fördern
Zukunftsängste und Dauerunsicherheit schlagen oft auch auf die körperliche und psychische Gesundheit. Unternehmen tragen zunehmend Mitverantwortung dafür, dass Arbeit nicht krank macht, sondern Resilienz unterstützt.
- Gesundheitsangebote nicht nur im akuten Krankheitsfall anbieten, sondern präventive Programme fördern (z. B. Resilienztrainings, Achtsamkeitsworkshops, Coachingangebote).
- Psychische Gesundheit ebenso enttabuisieren wie körperliche – z. B. durch Awareness-Kampagnen, offene Gesprächsformate, Buddy-Programme oder niedrigschwellige Unterstützungsangebote.
- Führungskräfte darin schulen, Warnsignale frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren.
Eines wird deutlich: Nicht nur die Anforderungen an Arbeitnehmerinnen verändern sich in Zukunft substanziell, auch die an Unternehmen. Am Ende geht es aber vor allem um eines: die menschliche Begegnung. Am sichersten fühlen Menschen sich, wenn sie gesehen, in ihren Sorgen ernst genommen und bei ihrer Überwindung unterstützt werden. Unternehmen und Führungskräfte, die Ängste sichtbar machen und zulassen, sie ansprechbar halten und mutig begleiten, ermöglichen nämlich echte emotionale Entwicklung und nachhaltige Performance im Team. Und damit ein Umfeld, das wächst. Betriebswirtschaftlich wie persönlich.
22.10.2025